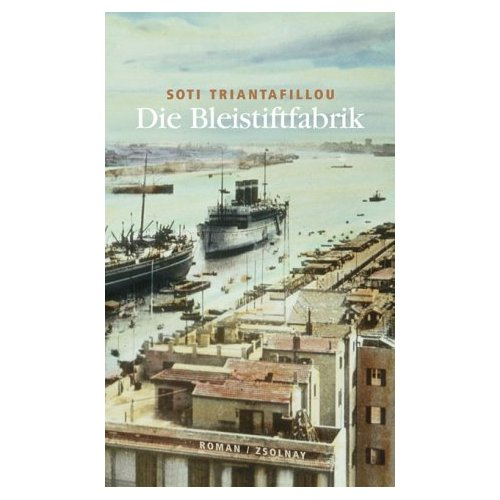
- Artikel-Nr.: SW209
Kurzbeschreibung Glückliche Liebschaften und unglückliche Ehen, ein Giftmord im Kongo und die... mehr
Produktinformationen "Triantafillou, Soti: Die Bleistiftfabrik"
Kurzbeschreibung Glückliche Liebschaften und unglückliche Ehen, ein Giftmord im Kongo und die russische Revolution - Soti Triantafillou erzählt die Geschichte einer griechischen Familie, die fast ein Jahrhundert umgreift und von Athen bis nach Brazzaville, von Paris bis St. Petersburg reicht. Großvater Stefanos hat in Suez am Kanal mitgebaut, sein Sohn Markos lässt sich als Eisenbahningenieur in Alexandria nieder und träumt davon, eine Bleistiftfabrik zu besitzen. Ein bewegender und fesselnder Roman über die Utopien und Schicksale der Familie Assimakis und ihrer Zeitgenossen in einer Zeit der Aufbruchsstimmung und des Fortschrittsoptimismus. Auszug aus Die Bleistiftfabrik von Soti Triantafillou. Copyright © 2004. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Rechteinhaber. Alle Rechte vorbehalten. Markos lebte geruhsam im griechischen Viertel von Alexandria; er arbeitete als verantwortlicher Ingenieur bei der ägyptischen Eisenbahn, eine Sisyphusarbeit, meinte er enttäuscht; in einem Brief, den er Vágalis nach Rußland geschickt hatte, schrieb er: »Die Brücke von Arta, die ägyptischen Eisenbahnlinien, die sozialistische Revolution: lauter Leistungen, die entstehen und wieder vergehen.« Während all dieser Jahre bekam Markos Briefe und Postkarten und Notizzettel – einmal knapp und voll trauriger Untertöne, dann wieder wortreich, überspannt, fiebrig; oft legte ihm Vágalis aus Zeitungen und Zeitschriften ausgeschnittene Seiten bei, Informationen und Reklamen zu Bleistiften: Bleistifte der New Yorker Marke Koh-I-Noor ohne Spitzen und Spitzer, Venus-Bleistifte, »der perfekte Bleistift«, Sheefer-Eaton-Stifte aus Iowa, USA, »das unvergeßliche Präsent«, und so weiter. In einem Brief hatte er Zuckerkristalle gefunden und daraus geschlossen, daß Vágalis beim Schreiben Zuckerstücke kaute – er folgte ihm von weitem, und der Gedanke an ihn ängstigte ihn ein bißchen: Markos zitterte davor, daß der Freund umgebracht werden könne, an den Strapazen sterben, an der Schlaflosigkeit, der mangelhaften Ernährung, an seinem geistigen Zustand selbst, »dem Nebel meines Gehirns und dem Sturm«, wie er es selbst nannte – vor allem hatte er die Befürchtung, er könne ihm vorhalten, daß er sich ihm nicht angeschlossen hatte, daß er der Sozialdemokratischen Partei damals nicht beigetreten war, wie er es ihm vorgeschlagen hatte, und wie er es später noch zweimal getan hatte; einmal war es im Jahr 1905 gewesen, im Jahr dieser mißglückten Revolution in Rußland. Markos erinnerte sich noch genau, wann Vágalis ihm erneut den Vorschlag gemacht hatte, Parteimitglied zu werden, denn während dieser Tage war Dilijánnis in Athen ermordet worden – und Markos hatte sich unwillkürlich gefreut. Er dachte, sein Vater hätte den Mord für Barbarei gehalten, obwohl er von Dilijánnis die übelste Meinung hatte; seine Mutter indessen hätte gesagt: »Das Land ist vom Unrat befreit! Zum Henker mit ihm!« – und Markos hatte sich einfach nur gefreut, er überlegte sich, wie man sich fühlen mußte, wenn man einen Politiker aus dem Weg räumte, der so sehr im Weg war. Er hatte Vágalis zweimal besucht, einmal damals im Jahr 19, als er mit dem Zug nach Berlin gefahren war und in Fürth Station gemacht hatte, bei der Faberschen Bleistiftfabrik, und viele Jahre danach, im Jahr 1916 – oder 1917 – war er nach Zürich gefahren, mitten im Krieg, als nichts mehr so war wie vorher. Er hatte Vágalis ein Tütchen Alexandriner Zimtbonbons mitgebracht, weil er nicht wußte, was er ihm sonst schenken sollte, und Vágalis hatte die Bonbons gelutscht und ihm von der Revolution im Bereich der Sozialdemokratie erzählt, ab und zu hatte er einen Moment pausiert, um den Bonbonrest hinunterzuschlucken. »Ich habe mich arrangiert wie eine Festung, die in sich zusammenfällt – ich bin passiv wie Louis XVI.«, hatte er Vágalis nach dem Treffen in Zürich geschrieben, und der hatte unerwartet erwidert: »Macht doch nichts. Gib nur acht, daß du nicht einschläfst.« Und hatte unten noch ein Gedicht von Nekrassow beigefügt: Gib acht, daß du beim Komponieren des verbotenen Liedes nicht für immer einschläfst. Markos verstand es nicht, doch er dachte: Wer nicht weiß, was er will, ordnet sich zu leicht unter. Er wußte nicht, was er wollte. Das einzige, was er gewollt hätte, wäre die Gründung einer Fabrik gewesen, die Herstellung von Bleistiften. Und daß mit diesen Bleistiften alle schrieben, die bis dahin nicht hatten schreiben können – das hätte er gewollt. In Griechenland eine westliche Fabrik gründen, eine Fabrik nach europäischem Standard; er hörte noch seinen Vater sagen: Griechenland kann ein Industriegigant werden! Doch im gleichen Moment fühlte er sich wie ein Kind, das nicht erwachsen werden und nicht einmal Entschlüsse fassen konnte, das taten andere für ihn. Er hatte oft Sehnsucht nach Dschibuti, nicht direkt nach Dschibuti, sondern nach den Kath-Blättern. Mein Leben, dachte er, wäre leichter, wenn ich am Rand des Gartens säße und zwei Blättchen im Mund hätte und an ihnen lutschen könnte, und dann noch zwei; Alexandria erschiene mir wie unterm Regenbogen. Als die Zeit so verging, dünkte ihn, daß er mindestens in zwei Leben lebte: zum einen lebte er als Eisenbahningenieur und als liberaler Republikaner wie Stéfanos Assimákis; zum anderen lebte er als Weggefährte der Revolutionäre, als einer derer, den die Russen popu_cik nannten – er hatte den Sozialisten zweimal von der Züricher Bank Geld anweisen lassen; obwohl er Vágalis nicht gefolgt war, liebte er die Idee der Revolution, auf eine eher allgemeine Weise, wie er es liebte, bei den Gesprächen in den Alexandriner Salons die Verfechter der Volkssprache zu unterstützen*. Und obwohl er nicht arm war, wußte er, was Beschränktheit und was Mittellosigkeit bedeutete, er hatte sie in Kairo erlebt und in Athen und in Dschibuti, vor allem in Dschibuti und in Abessinien, aber sogar in Zürich, in den Arbeitervierteln; und außerdem wartete er neugierig auf das, was nachfolgen würde, ob Köpfe rollen würden; und welche Köpfe. Zwischen diesen Leben glitt er hin und her und sprach mit keinem darüber; Sofía beklagte sich immer, daß sie nie wisse, was ihm im Kopf herumginge, daß er ständig mit den Gedanken woanders sei und sich nicht genug für seine Kinder interessiere; obwohl er, als Luisa Scharlach hatte – sie war damals fünf –, sehr erschrocken gewesen war und es auch gezeigt hatte. Doch Sofía sagte immer zu ihren Freundinnen, er sei eigenartig, er begleite sie nie auf Bälle. Mein Mann ist ungesellig, sagte sie. Das ist es nicht, dachte Markos, ich langweile mich nur – ich langweile mich.
Weiterführende Links zu "Triantafillou, Soti: Die Bleistiftfabrik"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Triantafillou, Soti: Die Bleistiftfabrik"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen
































